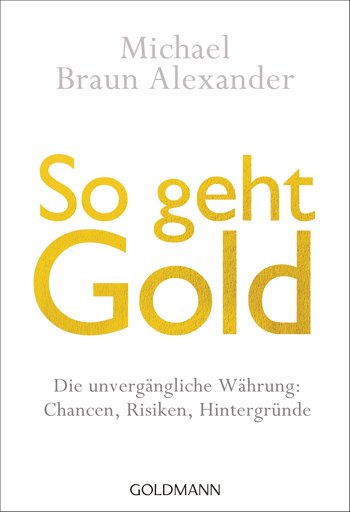So geht Gold. Buchvorstellung
Der Kompass fehlt
Der Untergang des Finanzsystems droht – Gold als Anker!
„Das wichtigste aller geldpolitischen Instrumente, der Zins, ist stumpf und unbrauchbar geworden. Jetzt fehlt den Märkten der Kompass.“ Der Wirtschaftsjournalist und Buchautor, Michael Braun Alexander, befürchtet in den kommenden Monaten weitere Turbulenzen für Finanzdienstleister und bricht eine Lanze für Gold zur Stabilisierung von Vermögen. In seinem Buch So geht Gold, das im Juli dieses Jahres im Goldmann-Verlag erschienen ist, setzt er sich intensiv mit dem Pro und Contra der unvergänglichen Währung Gold auseinander.
Herr Braun Alexander, kommen wir gleich auf den Punkt. Was spricht für Gold, was dagegen?
Gold ist im Wesentlichen eine Versicherung für den Fall, dass unsere Fiatwährung – also von Notenbanken aus der Luft erschaffenes Geld – eines Tages untergeht und damit auch das Finanzsystem, wie wir es seit Generationen kennen. Gold ist insofern kein Investment, sondern im Kern eine Währung, und zwar eine, die mit großer Wahrscheinlichkeit einen Wert behalten wird, komme was wolle. Gegen Gold – also physisches Gold wie Münzen, Barren und physisch sauber hinterlegte Anlageformen – spricht vor allem, dass es nicht rentiert und eine Spur mehr Arbeit macht als ein Festgeldkonto. Man muss es irgendwo aufbewahren, und das sicher. Für die langfristige Geldanlage, den Aufbau und die Mehrung von Vermögen, sind Beteiligungen an gut geführten Unternehmen, also Aktien, selbstverständlich viel geeigneter als Gold. Aber als Beimischung, als absichernder Posten, ist Edelmetall in vieler Hinsicht ideal.
Sie nennen Gold die „unvergängliche“ Währung. Wie würden Sie den Euro und andere Leitwährungen derzeit kennzeichnen?
Alle Währungen, mit denen wir heute vertraut sind – Euro, US-Dollar, Franken, Yen, Pfund und so weiter – sind so genannte Fiat-Währungen, mit nichts hinterlegt als dem Vertrauen der Bürger in die ewige Weisheit ihrer Notenbanken. Wie weit es mit der Weisheit der westlichen Notenbanken aktuell her ist, kann man herrlich kontrovers diskutieren. Für mich persönlich liegt deren Politik in den vergangenen Jahren – Zinsen als Marktregulativ eliminieren, Geld drucken, mehr Geld drucken, die Hubschrauber aus dem Hangar holen – am unteren Ende der Hoffnungen. Fiat-Währungen können nicht nur sterben, sie tun es leider auch ziemlich häufig – siehe in jüngerer und jüngster Zeit Venezuela, Simbabwe und andere spektakulär inkompetent regierte Länder. Auch so genannte Leitwährungen können sterben, wenn sie von Politikern und Notenbankern miserabel gemanagt werden. Sie sind höchst vergänglich. Leider.
Wie beurteilen Sie die Stabilität des Finanzsystems in Europa im Jahr 9 nach Ausbruch der Finanzkrise?
Die Ursachen der seit Sommer 2007 schwelenden Finanzkrise sind bis heute nicht gelöst, lediglich die akuten Symptome sind von der Politik im Zuge zahlloser Rettungsaktionen angegangen worden. Ursprünglich ging die Krise bekanntlich von den USA aus, wo eine Immobilienblase platzte. Diese Krise zog Banken, Versicherungen und andere Finanzunternehmen in einen Strudel, darunter einige der damals größten Finanzfirmen der Welt wie Bear Stears, Lehman Bros., AIG, Merrill Lynch und viele weitere. Auch Banken in Europa und in der Eurozone, mehrere davon in Deutschland, gingen unter, weil plötzlich die Liquidität an den Märkten versiegte. Die Rettungsaktionen, die die Regierungen in dieser kritischen Phase starteten, trieben wiederum die Verschuldung der Staaten auf neue Höchststände – und plötzlich waren nicht nur die Banken Pleitekandidaten, sondern die Staaten selbst. Griechenland und die übrigen PIIGS-Länder etwa. Bis heute hat sich daran nicht viel geändert: Schulden wohin man sieht, ermöglicht von den Notenbanken mit Null- und Negativzinsen und massiven Anleihekäufen. Das wichtigste aller geldpolitischen Instrumente, der Zins, ist stumpf und unbrauchbar geworden – den Märkten fehlt quasi der Kompass. Und die faulen Kredite von einst stehen bei vielen Banken in Europa immer noch in den Büchern und faulen weiter vor sich hin. Stabilität würde ich anders beschreiben.
Wie ernst schätzen Sie die Lage in Italien ein?
Sehr ernst. Die Situation ist von ausgesuchter Scheußlichkeit. Entweder die Regierung in Rom, schon heute überschuldet, „rettet“ die angeschlagenen Banken – was irrsinnig kostspielig ist und den aktuell geltenden Spielregeln in der Eurozone widerspricht. Oder sie lässt sie sterben. Das hätte erstens zur Folge, dass Millionen Italiener ihre Ersparnisse verlieren und in der Folge wahrscheinlich die Regierung stürzt. Zweitens würde in Europa und weltweit sofort wieder das Gespenst der finanzsystemischen Krise umgehen. Eine eher unschöne Gemengelage.
Auch in den soliden deutschen Kreditinstituten ist die Finanzkrise angekommen: Fusionierungen und rigorose Sparmaßnahmen sind die Folgen. Werden die Konsolidierungsmaßnahmen ausreichen, um Deutschland wieder auf einen stabilen Kurs zu bringen?
Ich weiß es nicht. Mit wem sollte beispielsweise die „solide“ Deutsche Bank, ein gigantischer Brocken, denn fusionieren? Deren Bilanz ist ungefähr so zugänglich und übersichtlich wie der Himalaja – mit dem Bulldozer kommen Sie da nicht weit. Ich persönlich bin seit langem überzeugt, dass wir mittelfristig ein neues globales Finanzsystem brauchen, einen Neustart. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern ist ein extrem komplexer, globaler, diplomatisch außerordentlich sensibler Prozess, der eher fünf Jahre als fünf Monate braucht. Dieses Zeitfenster haben die Notenbanken mit ihrer umstrittenen Niedrigzinspolitik und dem Quantitative Easing durchaus geöffnet. Die Tragik liegt darin, dass diese Chance von der Politik – stets nur aufs Klein-Klein und auf die jeweils aktuelle Krise fokussiert – nicht genutzt wurde.
Bis 1971 gab es die Golddeckung. Was ist seither mit den globalen Geldsystemen passiert und worauf wird es hinauslaufen?
Um es mit einem Bild zu sagen: Ein Segelschiff, das ohne Anker über die Weltmeere fährt, wird früher oder später trotz aller Umsicht des Kapitäns mit der Küste in Berührung kommen, also Schiffbruch erleiden. Die Golddeckung des US-Dollars – und damit indirekt der anderen Währung – ist so ein Anker gewesen, und er wurde Anfang der 1970er-Jahre über Bord geworfen, weil das damals opportun erschien. Die meisten Währungen haben seitdem massiv an innerem Wert verloren, also an Kaufkraft.
Kritiker halten entgegen, dass es ohne Aufhebung des Goldstandards keine wirtschaftliche Prosperität in diesem Maße gegeben hätte. Richtig oder falsch?
Wenn die Kritiker damit meinen, dass wirtschaftliche Prosperität nur jenseits eines Goldankers möglich ist: Unsinn. Die spätviktorianische Zeit, also etwa die Jahre zwischen 1871 und dem Ausbruch des ersten Weltkriegs, war eine Ära des wirtschaftlichen Booms, getragen von technischen Neuerungen, dem Aufstieg der USA, einer Phase des regen Welthandels und intensiver Globalisierung. Sie war auch die Hochzeit des Goldstandards.
Was macht die „unvergängliche Währung Gold“ also so wertvoll?
Die Werthaltigkeit von Gold und anderen Edelmetallen ist unabhängig von der Weisheit oder Torheit der Regierenden.
71 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges stehen wir wieder vor einem finanziellen Desaster. Was kann dem Anleger, den Banken, den Staaten Gold jetzt noch nutzen?
Na ja, aktuell – Mitte Juli – befinden wir uns natürlich nicht in einer akuten Krise, auch wenn das in einer Woche oder in ein paar Monaten schon ganz anders aussehen kann. Aber der Umstand, dass viele Notenbanken – die Federal Reserve, die EZB, auch die Bundesbank natürlich – weiterhin große Mengen an Gold vorhalten, deutet schon an, dass die Verantwortlichen Edelmetall weiterhin als Anker sehen, der in einer systemischen Krise eines Tages doch nützlich sein könnte. Das sagt natürlich keine Notenbank so, aber die Fakten sprechen für sich. Schwieriger werden es im Krisenfall jene Notenbanken und Nationen haben, die nur noch – soweit man das wissen kann – sehr übersichtliche Goldreserven haben, etwa Großbritannien und Kanada.
Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung der nominalen Anlageklassen ein?
Ich bin pessimistisch. Wir erleben schon seit Jahren eine hohe Inflation bei „realen“ Vermögenswerten, etwa bei Immobilien und Aktien. Früher oder später wird diese Inflation auch bei den Verbraucherpreisen ankommen, fürchte ich. Nominale Anlageformen haben im Verhältnis zu realen Werten bereits erheblich an Kaufkraft verloren. Diese Entwicklung dürfte sich fortsetzen.
Lassen Sie mich nachhaken: unterscheiden Anleger zwischen nominal und real?
Ich glaube, einem Großteil der Menschen in Deutschland ist dieser Unterschied nicht klar, und sie denken auch gar nicht darüber nach. Das ist gefährlich, denn schätzungsweise mehr als 70 Prozent der Ersparnisse der Bundesbürger haben sie in ganz oder überwiegend nominale Anlageformen gesteckt, die langfristig erhebliche Risiken bergen – beispielsweise in Tages- und Festgeld, in Kapital-Lebensversicherungen oder in nicht inflationsgesicherte Anleihen.
Großbritannien will den Brexit. Was bedeutet der Ausstieg Ihrer Meinung nach für die wirtschaftliche Prosperität Europas?
Kurz- und mittelfristig ist das eine bedrohliche und risikobehaftete Entwicklung, und die mehrere Jahre andauernde Phase eines Brexit sorgt politisch und wirtschaftlich für große Unsicherheit. Aber wie bei jeder Scheidung gilt auch hier: Man kann, wenn man es erwachsen und umsichtig angeht, auch nach einer vollzogenen Trennung befreundet sein – also offene Wirtschaftsräume und Grenzen haben und gemeinsam prosperieren. Langfristig könnte ich mir vorstellen, dass der Brexit für Großbritannien – oder auch Klein-Britannien, niemand weiß es genau – wirtschaftlich durchaus positive Folgen hat. Es gibt eine Reihe von Ländern in Europa, die nicht Mitglied der EU sind und wirtschaftlich blendend dastehen, zum Beispiel Norwegen und die Schweiz. Aber das politische Signal, das mit dem Brexit einhergeht, ist düster. Der Brexit könnte eine historische Trendwende in Europas Geschichte markieren. Sobald ein anderes Mitgliedsland der EU Differenzen irgendwelcher Art mit den Partnerländern bekommt, könnte es sagen: ‚Dann verabschiede ich mich eben auf die britische Art, adieu.’
Sie leben und arbeiten in Berlin und Indien. Eröffnet sich mit diesen beiden Perspektiven per se ein anderer Blick auf Gold?
Oh ja. Definitiv.
Welcher?
Gold ist in Indien – unterm Strich, also pro Kopf der Bevölkerung, ein deutlich ärmeres Land als Deutschland – seit Jahrtausenden eine alltägliche Anlageform gewesen und ist es bis heute. Was bei uns einst das Sparbuch war, also ein normaler, vernünftiger Aufbewahrungsort für Notgroschen, Ersparnisse und Vermögen, ist in Indien traditionell der „Sparschmuck“ der Frauen. Das machte Sinn. Die Landeswährung, die indische Rupie, war lange Zeit inflationär; Gold war und ist es nicht, bietet also Schutz gegen schleichende Geldentwertung. Hinzu kommt, dass noch vor zwei Jahren etwa die Hälfte der Inder kein Konto hatte und natürlich auch kein Sparkonto. Für diese sehr große Gruppe gilt: Entweder man lässt die Ersparnisse irgendwo liegen, was riskant ist, oder man trägt sie am Körper und hat sie bei sich.
Können wir von Inderinnen lernen?
Ja und nein. Gold ist nützlich für den Kaufkrafterhalt von Ersparnissen. Aber Inderinnen setzen natürlich auch deshalb auf Goldschmuck, weil sie keine Alternativen haben – also kein Konto und erst recht kein Anlagedepot bei einer Bank. Sie haben daher oft das, was man ein Klumpenrisiko nennt: Sie besitzen Gold und Silber und Schmuck – und sonst wenig. Das ist in dieser Konsequenz auch wieder nicht vernünftig. Man sollte als Sparer und Vorsorger nie – wirklich nie – alles auf eine Karte setzen. Wer nur Gold besitzt und sonst nichts, macht meines Erachtens einen Fehler. Man sollte Risiken stets verteilen und muss sich Gedanken über die sinnvolle Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen machen – das, was man im Englischen Asset Allocation nennt. Das ist der Anfang der Geldanlage. Diese Asset Allocation ist bei Inderinnen, die Goldschmuck besitzen und sonst wenig, eher nicht so günstig.
Autorin: Martina Beierl